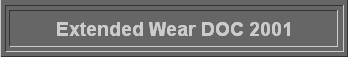
Diese Arbeit wurde in der DOC-Kongreß Ausgabe Nr. 1 von Mai 2001 der Zeitschrift Ophthalmologische Nachrichten veröffentlicht.
Extended Wear von Kontaktlinsen im historischen Vergleich: Wohin fĂĽhrt der Weg?
René Mély, Saarlouis
Das permanente Tragen von Hydrogellinsen („extended wear“) wurde zum ersten Mal 1981 von der amerikanischen FDA genehmigt. Bereits 1988 betrug der Anteil an den insgesamt getragenen Kontaktlinsen in USA 30%, in Dänemark 50% und in Schweden 25 %. In der BRD gab es dagegen nur 2-3,5% vT-Linsenträger. Leider folgten bald in den Medien und in der Fachliteratur erschreckende Berichte über die damit verbundene, hohe Inzidenz von Hornhautulzera und vT-Linsen gerieten in Fachkreisen völlig in Verruf.
Mikrobielle Hornhautulzera stellen die gefährlichste Komplikation dar, die durch Tragen von Kontaktlinsen auftreten kann. Diese Visus-bedrohende Hornhautinfektion wird vor allem von gramnegativen Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa und seltener von anderen Mikroorganismen wie Amöben oder Pilzen verursacht.
Mikrobielle Hornhautulzera müssen differentialdiagnostisch von so genannten sterilen Keratitiden, wie z.b. peripheren Hornhautinfiltraten, unterschieden werden. Auch diese Veränderungen treten besonders häufig (5%) bei vT-Linsenträgern auf (Grant 1998). Als Ursache wird eine Hypersensitivitätsreaktion vom Typ III auf Staphylokokken diskutiert. Die Heilung erfolgt jedoch mit oder ohne Therapie innerhalb weniger Tagen (Cohen 2000).
Die Sauerstofftransmissibilität der Linsen spielt eine Schlüsselrolle in der Entstehung von Mikrobiellen Hornhautulzera
Die Pathophysiologie von mikrobiellen Hornhautulzera bei vT-Linsenträgern wurde in den letzten Jahren weitgehend geklärt. Neue Untersuchungen bei Trägern von Silikonhydrogellinsen zeigen, dass die Linsen in einem hohen Maß von nicht pathogenen grampositiven Bakterien der normalen Lid- und Bindehautflora kontaminiert werden (Keay, 2001). Diese Kontamination nimmt im Laufe der Zeit nicht zu und unterscheidet sich nicht wesentlich von der Kontamination von Tageslinsen. Ein Zusammenhang mit dem Auftreten von entzündlichen Bindehaut- und Hornhautreaktionen wird angenommen, aber diese bakterielle Besiedlung scheint keine wichtige Rolle bei der Entstehung von bedrohlichen Hornhautinfektionen zu spielen. Erst in den letzten Jahren wurde erkannt, dass hier die Sauerstofftransmissibilität der Linsen eine Schlüsselrolle einnimmt.
Ein Hornhautulkus kann sich nur unter folgenden Voraussetzungen entwickeln:
- Zum einen muss ein Epitheldefekt als Eintrittspforte vorhanden sein. Dies kann durch Ein- und Aussetzen der Linsen oder durch die abrasive Wirkung von Ablagerungen geschehen. Vor allem können aber Defekte durch eine Hypoxie bedingte Epitheldesquamation der Hornhaut entstehen.
- Zum anderen müssen die Bakterien an den Linsen und an den Epithelzellen haften. Auch hier spielt die Hornhauthypoxie eine ganz wesentliche Rolle. Mehrere Untersuchungen, darunter die Arbeit von Ren (1999), haben bewiesen, dass es eine signifikante Korrelation zwischen Adhärenz von Pseudomonas aeruginosa an Hornhautepithelzellen und Sauerstofftransmissibilität der Linsen gibt.
Untersuchungen von Holden (1984) haben gezeigt, dass die Sauerstofftransmissibilität einer Kontaktlinse die nachts getragen wird mindestens 84 x 10-9 betragen muss, um eine Zunahme des physiologischen Hornhautödems zu vermeiden („zero residual swelling“). Nach neueren Untersuchungen von Harvitt und Bonanno (1999) sollte der Dk/t-Wert sogar 125 x 10-9 erreichen. Konventionelle Hydrogellinsen können höchstens eine Sauerstofftransmissibilität von 30 bis 40 x 10-9 erreichen und sind im Grunde genommen als vT-Linsen obsolet. Die neuen Silikonhydrogelcopolymere besitzen einen Dk/t-Wert von 110 x 10-9 (Balafilcon A, Pure Visionâ) bzw. 175 x 10-9 10-9 (Lotrafilcon A, Focus Night & Dayâ) und liegen somit deutlich über den von Holden bzw. Bonanno geforderten Werten. Auch beim geschlossenen Auge ist bei diesen Linsen keine relevante Zunahme der physiologischen Hypoxie der Hornhaut mehr festzustellen.
Hohe Komplikationsrate der konventionellen vT-Linsen
In einer Untersuchung von Poggio und Mitarbeitern (1989) betrug die Inzidenz von Hornhautulzera 4,1/10.000 Fälle beim daily wear und 20,9/10.000 Fälle beim extended wear. Auch Schein und Mitarbeiter (1989) fanden, dass die Infektionen 5 bis 15 mal häufiger beim extended wear auftreten als beim daily wear.
Als die ersten Einweglinsen (Acuvueâ,1987) auf den Markt kamen, erhoffte man die Komplikationsrate durch eine bessere Linsenhygiene reduzieren zu können.
In einer sehr großen retrospektiven Studie (Nilsson et al. 1994) wurden sämtliche schwere Keratitiden, die über einen Zeitraum von 3 Jahren in Schweden stationär behandelt wurden, untersucht. Diese Untersuchung zeigte, dass die Komplikationsrate des daily wear durch Austauschlinsen deutlich reduziert werden konnte (0,16/10.000) im Vergleich zu konventionellen Linsen (0,51/10.000). Die Komplikationsrate von vT-Linsen war aber immer noch wesentlich höher, sowohl bei konventionellen Linsen (3,12/10.000), wie auch bei Einweglinsen (4,17/10.000).
Sind die neuen Silikonhydrogel-vT-Linsen eine sichere alternative zur Refraktiven Chirurgie?
Die Komplikationsrate der neuen Silikonhydrogellinsen müsste theoretisch wesentlich geringer sein und die bisher publizierten Untersuchungen scheinen dies zu bestätigen. Die Zahl der Träger von Silikonhydrogel-vT-Linsen wird weltweit auf ca. 100.000 geschätzt und die Beobachtungszeit beträgt bis zu 4 Jahre. Es wurde bisher kein einziger Fall von mikrobieller Keratitis publiziert. Es kann jedoch angenommen werden, dass es bereits eine Handvoll unveröffentlichter Fälle gibt. Die bisher veröffentlichten Studien umfassen ca. 3500 Patienten und berichten lediglich über entzündliche Bindehaut- und Hornhautreaktionen. Wir brauchen aber mindestens 10.000 Patienten, um die Inzidenz von schweren Komplikationen besser einschätzen zu können. Nimmt man jedoch als Grundlage die von Nilsson berechnete Inzidenz, dann wären bei derzeit ca. 100.000 Trägern ca. 40 schwere Hornhautulzera zu erwarten. Sollte es sich bestätigen, dass es zur Zeit nicht mehr als 5 Ulzera bei 100.000 Trägern gibt, dann wäre die Inzidenz vom extended wear von Silikonnhydrogellinsen nicht höher als die Inzidenz von konventionellen weichen Linsen im täglichen Tragemodus.
Diese bisher sehr niedrige Komplikationsrate rechtfertigt den Einsatz dieser Linsen sowohl bei den klassischen medizinischen Indikationen von vT-Linsen (z.b. als Verbandlinsen) wie auch bei kosmetischen Indikationen. Vieles deutet darauf hin, dass wir mit den neuen Silikonhydrogellinsen auf dem richtigen Weg sind und wir unseren Patienten eine sichere alternative zur refraktiven Hornhautchirurgie anbieten können.
Literatur
1. Grant T, Chong MS, Vajdic C, Swarbrick HA, Gauthier C, Sweeney DF, Holden BA: Contact lens induced peripheral ulcers during hydrogel contact lens wear. CLAO J 1998;24:145-151.
2. Cohen EJ: Management of small corneal infiltrates in contact lens wearers. Arch Ophthalmol 2000;118:276-277.
3. Keay L. u. Mit.: Bacterial populations on 30-night extended wear silicone hydrogel lenses. CLAO J 2001;27:30-34.
4. RenD.H. u. Mit.: CLAO J 1999;25:80-100
5. Holden B, Merz G: Critical oxygen levels to avoid cornea edema for daily and extended wear contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 1984;25:1161-1167.
6. Harvitt D, Bonanno J: Reevaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid cornea anoxia. Optom Vis Sci 1999;76 (10) 712-719.
7. Poggio u. Mit. (NEJM 321, 779-783, 1989)
8. Schein u. Mit. (NEJM 321, 773-778, 1989
9. Montero J u. Mit.: Practical experience with a high Dk Lotrafilcon A Fluorosilicone Hydrogel extended wear contact Lens in Spain. CLAO J 2001;27:41-46.